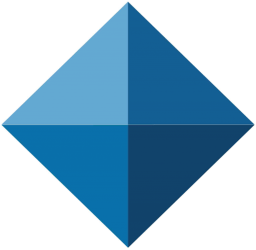Wahnsinn No. 2
Eine psychotherapeutische Praxis im Niemandsland. Besorgte Eltern machen sich für ihre 16 jährige Tochter einen Termin aus. Die Tochter war zuletzt im Bezirkskrankenhaus wegen einer psychotischen Störung behandelt worden. Konkret hatte das Mädchen nach einer durchzechten Nacht nicht nur Stimmen gehört sondern sich auch höchst erregt mit diesen Stimmen unterhalten.
Nach der Ausnüchterung war das Mädchen immer noch in einem erregten Zustand, die von ihr berichteten Bilder waren sexuell aufgeladen und wahnhaft gefärbt. Konzentration, Merkfähigkeit und Gedächtnisfunktion waren beeinträchtigt, das formale Denken ließ sich als deutlich verlangsamt, inkohärent und und zerfahren bewerten. Weiters bestand eine Beeinträchtigung in der zeitlichen Orientierung.
Nach einigen Tagen des stationären Aufenthalts wurde die Patientin zur ambulanten Nachbehandlung entlassen, wobei diese im Spital erfolgen sollte. Im Zuge dieser Behandlung hat die behandelnde Ärztin den Eltern eine psychotherapeutische Behandlung der Tochter empfohlen.
Bei diesem Erstgespräch, an dem sowohl die Eltern als auch die Tochter teilnehmen, vermitteln erstere den Eindruck einer unbeholfenen Überfürsorglichkeit, während die Tochter medikamentös offensichtlich gut eingestellt, langsam im Gedankengang aber klar in ihrer Haltung von ihren Eltern fordert, diese mögen ihr mehr Freiheit lassen.
Im Zuge der Abklärung der Erwartungen kommunizieren die Eltern, sie würden alles für ihr Kind tun, nur damit es ihr besser ginge. In ihrem Verhalten aber vermitteln sie den Eindruck, als ob neben der offensichtlichen Sorge um die Tochter auch ein großes Kontrollbedürfnis herrsche. Wann immer die Tochter zu eigenen Gedanken und Erklärungen ansetzt, fühlen sich die Eltern berufen, diese Aussagen zu interpretieren. Gar nicht so selten kommt es vor, dass die von den Eltern gegebene Interpretation deutlich vom Sinn der Aussage der Tochter abweicht.
Die Tochter wiederum wirkt – abgesehen von der gestellten Forderung – sehr eingeschränkt in ihrer Wahrnehmung von der Welt. Wenig scheint sie zu interessieren. Gefühlsmäßig berührt zeigt sie sich vor allem von dem Umstand, dass ihr die Eltern ihr neu entdecktes Interesse für Burschen partout zu hintertreiben suchen.
Vereinbart wird, dass die Tochter einmal wöchentlich zur Therapie kommt und die Eltern bei Bedarf beraten und über die grobe Linie der Therapie informiert werden.
Im Zuge von drei, vier Sitzungen verfestigt sich das Bild vom Erstgespräch. Die Patientin ist und bleibt wenig affizierbar, beantwortet Fragen einsilbig mit „ja“ oder „nein“ und zeigt wenig Bereitschaft sich mit Fragen – welcher Art auch immer – auseinanderzusetzen. Einzig rund um das Thema persönliche Freiheiten und „Burschen treffen“ wird sie „lebendig“.
Therapeutisch betrachtet ist die Haltung der Tochter durchaus hilfreich und in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Zum einen in Richtung der Diagnose selbst: Während es im klinischen Bild der akuten Schizophrenie oder einer post-psychotischen Phase durchaus Episoden gibt, in denen die PatientInnen sehr abwesend und einsilbig wirken und kaum berührbar scheinen, so ist es höchst ungewöhnlich, dass sich bei derselben PatientIn im selben Zeitfenster für einen klitzekleinen Bereich ihres Lebens krankheits- und medikamentös bedingte Schleier lichten und sie glasklar, angemessen strukturiert, reflektiert und affizierbar ihre Interessen artikuliert und mit Verve vertritt. Das fordert zum Nachdenken.
Weiters ist bei diesem Zustandsbild natürlich an eine Kooperation mit der behandelnden Ärztin zu denken. Was sind deren Beobachtungen und Überlegungen? Lässt sich unter Umständen an eine Veränderung der Medikation denken, etc…
Für die Zusammenarbeit mit der Patientin lässt sich dieser kleine Ausschnitt utilisieren: Rund um das Thema lassen sich eine Reihe von Fragestellungen denken, die in ihrem Gesamt auf jene Fähigkeiten abzielen, die zur Bewältigung eines gelingenden Alltags beitragen: Kann und mag sie sich mit Freunden und Freundinnen treffen? Kann man sich gemeinsam in einem Lokal sehen lassen, nachdem alle im Ort wissen, dass sie „krank“ ist/war? Wie geht sie mit dieser Prüfungssituation um? Wie lange hält sie es aus, sich auf das Gegenüber, die Sache zu konzentrieren? Wäre sie bereit wieder in die Schule zu gehen, wenn sie sich dafür gelegentlich mit Burschen treffen dürfte? Interessanter Weise zeigt sich die PatientIn in diesen Fragen sehr kooperativ und kann auch durchaus Bedenken anerkennen, die der Erreichung ihres Zieles im Weg stehen.
Die Kooperation mit den Eltern erweist sich schwieriger. Nach der ersten gemeinsamen Stunde vermitteln sie den Eindruck, als ob sie am liebsten ihre Tochter zur Reparatur abgeben würden und zeigen dabei wenig Interesse am Fortschritt der Therapie. Nach vier Sitzungen wird eine gemeinsame Sitzung organisiert, in der die Tochter ihren Eltern einen Plan vorstellen soll, den die Eltern durchaus kritisch kommentieren und – ganz unabhängig davon – ihre Bedenken zum Ausdruck bringen können sollen. Konkret will die Tochter – so wie früher auch – sich mit ihren FreundInnen treffen und an den dörflichen Veranstaltungen teilnehmen. Selbstverständlich verfolgt sie dabei das Ziel, auch den einen Burschen weiterzusehen, der ihr sein Interesse an ihr deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Im Tauschgeschäft wäre sie bereit, auf eine Vielzahl von Forderungen einzugehen, jedenfalls aber auch die Schule zu besuchen. Die Eltern zeigen sich nicht gänzlich abgeneigt, in ihren Bedenken aber führen sie vor allem solche Beobachtungen von Alltagssituationen an, in denen die Tochter versagt hat. Die gemeinsame Sitzung endet mit nur einem konkreten Ergebnis: Man wird – eher aus therapeutischen Gründen denn aus Überzeugung – der Tochter den Schulbesuch erlauben; und bis zum Schuleintritt soll die PatientIn ihre bisherigen Freizeitbemühungen fortsetzen, allerdings um den Faktor Sport erweitern. Denn besondere Sorge mache den Eltern der schwächliche körperliche Gesamteindruck.
Die Sitzung darauf ist die Patientin sehr einsilbig und niedergeschlagen; die Eltern hätten den Worten wenig Taten folgen lassen; indirekt vermittelt die Patientin, dass auch das Vertrauen in die Therapie angeknackst sei. An beiden Themen wird gearbeitet, am Ende geht die Patientin mit mehr Zuversicht aus der Stunde als sie gekommen ist.
Wenige Tage später meldet sich der Vater telefonisch: Er habe mit seiner Frau besprochen, die Tochter nicht nur aus der Therapie zu nehmen sondern in seine ferne Heimat zu transferieren. Er und seine Frau hätten nicht die Kapazitäten, sich angemessen um das kranke Kind zu kümmern. In seiner Heimat aber wäre seine Schwester mit einer gleichartigen Tochter zu Hause und würde sich freuen, dem fernen Bruder und ihrer Nichte zu helfen. Die Tochter würde in den nächsten Tagen in die Fremde transferiert werden. Punkt. Aus. Ende der Kommunikation.