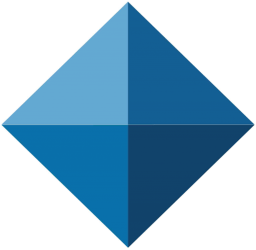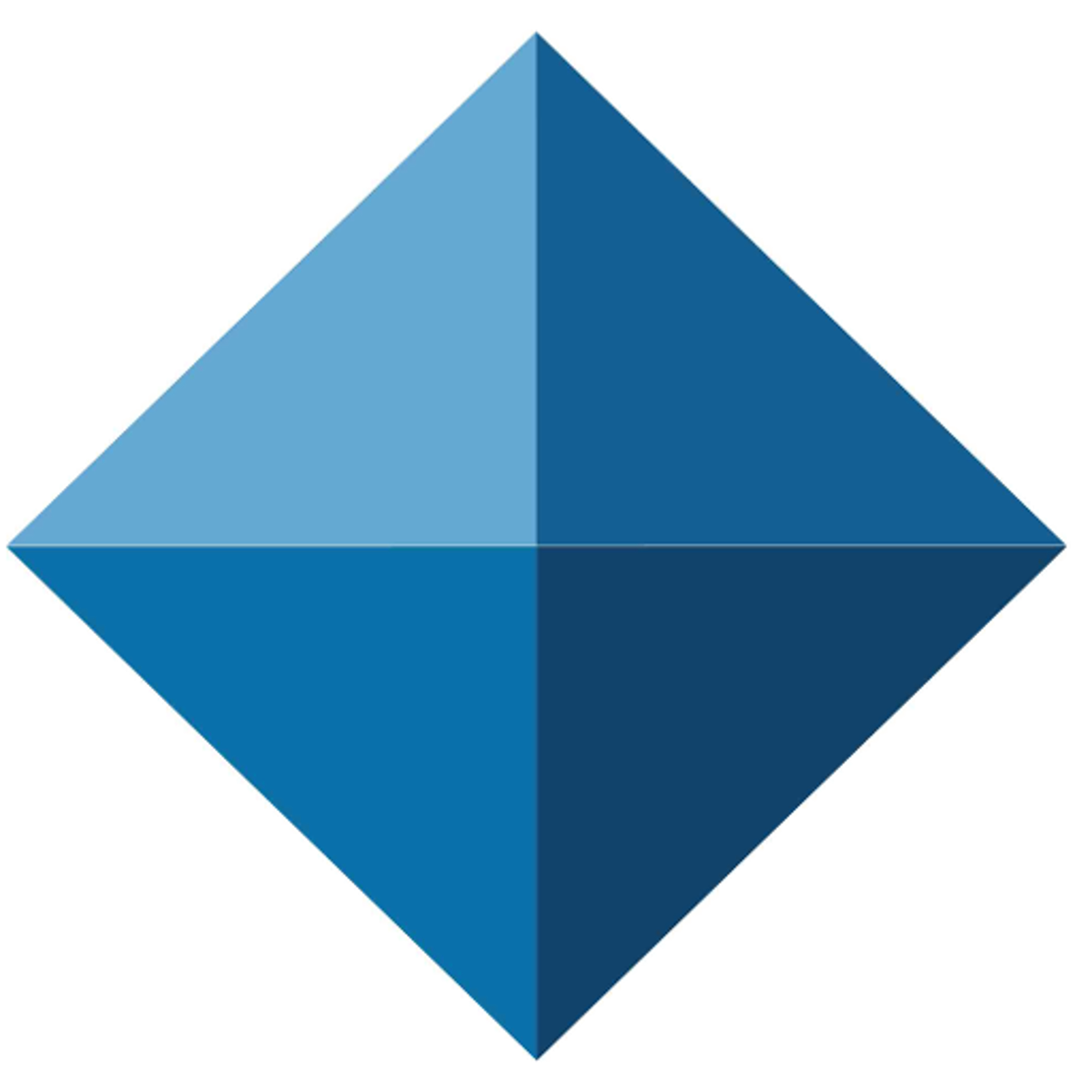In einem Beitrag von Bernd Koschuh für das Morgenjournal vom 11.12.2013 wird auf die deutlich gestiegenen Fälle von Besachwalterung eingegangen. Um 28 Prozent sei die Zahl der so entmündigten Personen in den letzten 5 Jahren gestiegen. Koschuh lässt in seinem Beitrag 3 Personen zu Wort kommen: Peter Barth, Familienabteilungsleiter im Justizministerium, Erich G., ein Betroffener mit Lernschwierigkeiten, wie er sagt und Peter Hacker, Geschäftsführer vom Fonds Soziales Wien.
Während Barth durchaus kritisch meint, dass behinderte oder psychisch kranke Menschen oft deshalb „besachwaltet“ werden, weil sie für Sozialleistungen der Länder Anträge stellen müssen, dies aber oft nicht können und die Behörden dann – im Sinne der Vereinfachung des Arbeitsaufwandes- von sich aus einen Antrag auf Sachwalterschaft stellen würden. Hier würde, so meint er, das ‚letzte Mittel‘ in der Kommunikation zwischen BürgerInnen und Behörden als erstes eingesetzt werden. Erich G. ergänzt dazu, die Behörden würden die Sachwalterschaft aus einem – falsch verstandenen – Schutzgedanken gegenüber den Betroffenen einsetzen. Peter Hacker führt einen weiteren Gedanken in die Diskussion ein: „Wir können als Sozialbehörde nicht mehr nach dem alten Fürsorgegedanken, der schon seit vielen Jahrzehnten tot ist, selbstständig entscheiden.“ Sondern: man müsse und wolle Menschen mit Einschränkungen als selbstentscheidungsfähige Kunden sehen. Deshalb die Anträge, so Hacker: „Wir sind verpflichtet, per österreichischem Gesetz, beidseitig gültige Verträge zu unterzeichnen. Das geht nur mit Menschen, die voll entscheidungsfähig sind. Und wenn nicht, dann braucht es eine Sachwalterschaft.“
Peter Hacker nimmt hier offensichtlich eine pragmatische Position ein: Die Gesetze sind wie sie sind, diese gelte es zu vollziehen. Diesen Pragmatismus möchte man so mancher ManagerIn nur wünschen. Nicht lange herum diskutieren und wehleidig sein, stattdessen mit dem Gegebenen umgehen und bei Bedarf einfach zupacken.
Jetzt ist Peter Hacker aber nicht irgendwer. Er ist Chef einer der größten Einrichtungen der Sozialen Arbeit in Österreich. Darüber hinaus hat der FSW eine besondere Stellung im österreichischen Sozialwesen: Der FSW erbringt nicht nur viele Dienstleistungen in dem Bereich selbst sondern er vergibt darüber hinaus Aufträge, die ein Vielfaches des Budgets für die eigenen Arbeitsleistungen betragen. So hängen alle großen Träger sozialer Einrichtungen, wie zum Beispiel Caritas und Volkshilfe, am Fördertopf des FSW. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, der FSW ist ein Leitbetrieb der Sozialen Arbeit in Österreich. Von einem solchen aber darf man sich eine etwas differenziertere Stellungnahme erwarten.
Die Soziale Arbeit ist ethischen Standards verpflichtet: international vereinbart, mit der Erlaubnis sie auf nationaler Ebene zu schärfen. Einer dieser Standards ist die Berufung auf die Menchenrechts-Charta und darauf aufbauender Deklarationen, wie z.B. die Deklaration von Madrid. Darin heißt es unter anderem: „Weg davon, dass Professionelle Entscheidungen für Behinderte Menschen treffen …“ sowie „nichts über behinderte Menschen (sagen, schreiben, tun) ohne behinderte Menschen (einzubeziehen)“. Und die Soziale Arbeit verpflichtet sich darüber hinaus zu einer Haltung, die in der Lehre als „allparteilich“ bekannt ist, allerdings mit dem Zusatz „im Zweifel für den Schwächeren“. Hacker macht genau das nicht. Er bezieht nicht Position für ‚die Schwächeren‘ sondern zieht sich auf die Position eines zynischen Machers zurück: Sie sind doch selber schuld, die Tschaperln, wenn’s das nicht können.
Da hat er offensichtlich etwas nicht verstanden. Wie das mit der Sozialen Arbeit und ihren Verpflichtungen gegenüber der Profession ist. Oder vielleicht doch? Vielleicht hat er es nur zu gut verstanden und hat beschlossen, dass mit diesem wehleidigen SozialarbeiterInnen-Gelaber Schluss sein muss. Vielleicht ist er ein braver Erfüllungsgehilfe seiner Herrn im Wiener Rathaus? Die schon lange die Nase voll haben von dieser selbsternannten Menschenrechtsprofession und es ganz gerne sehen, wenn endlich ‚gemacht‘ wird, egal wie. Beispiele dafür gebe es viele. Nicht nur in Wien, aber auch: Die Vereinnahmung der Drogenarbeit durch die Drogenkoordination und damit verbunden ein Hochleben der Bürokratisierung, zum Preis des Untergangs passgenauer Hilfebemühungen. Weiter die de-facto Übernahme der Gemeinwesenarbeit in Wien durch das Werbebüro des Wohnbaustadtrats, mit dem Ergebnis, dass z.B. Konflikte in Wohnhausanlagen nicht mehr partizipativ gelöst werden sondern bürokratisch.
Jetzt sei es der Rathausverwaltung und ihren EntscheidungsträgerInnen natürlich unbenommen, sich Einrichtungen der Sozialen Arbeit zu wünschen, die mit den Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen im Rathaus kompatibel sind. Ja, eh! Möglicherweise haben es die bisherigen Einrichtungen der Zivilgesellschaft sträflich vernachlässigt, die Sprache der Bürokratie zu lernen und den EntscheidungsträgerInnen in deren Sprache die Anliegen der von Ausgrenzung Bedrohten nahezubringen. Hunderte Laufmeter Studien belegen, dass man soziale Missstände nicht wegadministrieren kann. Es braucht passgenaue Hilfen.
Im Fall der von Besachwalterung bedrohten Personen: gut überlegte Unterstützungsleistungen, die den ethischen Standards der Profession genügen. Und im Fall von Herrn G. wäre es besonders einfach. Die Stadt Wien freut sich seit Jahren darüber, dass sie beispielsweise ihre Homepage – zumindest in Ansätzen – behindertengerecht gestaltet. Der nächste logische Schritt: Die Formulare in ‚einfacher Sprache‘ gestalten. Dann kann Herr G. selbst seine Formulare ausfüllen und würde sich möglicherweise so eingeladen fühlen, am sozialen und politischen Leben der Stadt teilzunehmen.